
Bild von WikimediaImages auf Pixabay
Die weit verzweigte Familie der Pappeln ist eigentlich an feuchten Flussufern heimisch. Noch eher kennen wir sie aber als typische Stadt- und Alleebäume. Vor allem die charakteristischen schlanken Pyramidenpappeln (Populus nigra italica) werden gern als Windschutz für Straßenränder oder zur Begrünung neuer Siedlungen gepflanzt. „Schuld“ daran war ursprünglich Napoleon Bonaparte: Er ließ seine Heerstraßen um 1750 massenhaft mit der importierten, schnell bis zu 30 Meter hoch wachsenden Baumart beschatten und markieren. Diese Tradition hat sich bis heute gehalten, obwohl oft spätestens nach 20 Jahren das große Schimpfen folgt, weil die kräftigen Wurzeln Gehwegplatten anheben oder Wasserleitungen sprengen. Deutlich harmloser ist die im Frühsommer massenhaft fliegende sogenannte Pappelwolle, in der die Samen des lebenstüchtigen Baumes weite Strecken fliegend überwinden. Mancherorts könnte man sich zur Zeit der Pappelblüte in einem lange nicht staubgewischten Spukschloss voller Staubmäuse wähnen! Dazu passt der altgriechische Mythos, dass am Eingang der Unterwelt eine Schwarzpappel steht und am Ausgang eine Weißpappel.

Bild von Susann Mielke auf Pixabay
Doch es ist nicht nett, dass wir diesen Text mit Nachteilen beginnen, ist die Pappel doch ein Baum mit grundlegend positiven Eigenschaften. In ihrer hochgewachsenen Krone etwa finden viele Tierarten wie Vögel, Fledermäuse, Eichhörnchen und Insekten Schutz. Im städtischen Raum filtern die unterseits filzig behaarten Blätter der Silberpappel (Populus alba) große Mengen an Feinstaub und tragen so zur Luftreinhaltung bei. Aus dem weichen, ergiebigen Pappelholz werden Zigarrenschachteln, Drechselarbeiten, Streichhölzer, Papier, Kohle und die traditionellen holländischen „Klompen“ gefertigt. Mit Pappelblättern fütterte man früher das Vieh, die stark gerbstoffhaltige Rinde war ein begehrter Grundstoff in der Herstellung von Leder – ja sogar die Pappelwolle wusste man als weiche Kissenfüllung zu gebrauchen.
 Allein schon diese Fülle an Talenten hätte für die Auszeichnung der Schwarzpappel (Populus nigra) als „Baum des Jahres 2006“ satt ausgereicht. Doch es geht noch weiter, denn auch in der Naturheilkunde haben Pappel-Zubereitungen seit Jahrtausenden einen festen Platz. Bereits der griechische Arzt Pedanios Dioskurides beschrieb etwa um 60 n.Chr. in seiner Materia medica die Wirkung von Pappelblättern und -rinde gegen Harnzwang, Gicht und Ohrenschmerzen. Die Wirkung einer Pappelsalbe gegen Hauterkrankungen aller Art lobten später sein Kollege Claudius Galenus von Pergamon (129–201 n.Chr.), die deutsche Äbtissin Hildegard von Bingen (1098–1148) und viele weitere Kräuterkundige. Die bekannteste Rezeptur dürfte wohl die Pappelknospen-Salbe „unguentum populeum“ sein, mit der man ab dem 17. Jahrhundert annähernd jede Hautkrankheit erstaunlich erfolgreich behandelte.
Allein schon diese Fülle an Talenten hätte für die Auszeichnung der Schwarzpappel (Populus nigra) als „Baum des Jahres 2006“ satt ausgereicht. Doch es geht noch weiter, denn auch in der Naturheilkunde haben Pappel-Zubereitungen seit Jahrtausenden einen festen Platz. Bereits der griechische Arzt Pedanios Dioskurides beschrieb etwa um 60 n.Chr. in seiner Materia medica die Wirkung von Pappelblättern und -rinde gegen Harnzwang, Gicht und Ohrenschmerzen. Die Wirkung einer Pappelsalbe gegen Hauterkrankungen aller Art lobten später sein Kollege Claudius Galenus von Pergamon (129–201 n.Chr.), die deutsche Äbtissin Hildegard von Bingen (1098–1148) und viele weitere Kräuterkundige. Die bekannteste Rezeptur dürfte wohl die Pappelknospen-Salbe „unguentum populeum“ sein, mit der man ab dem 17. Jahrhundert annähernd jede Hautkrankheit erstaunlich erfolgreich behandelte.
Das moderne Pendant dazu sind traditionelle „Grüne Salben“, die v.a. in der Tiermedizin nach wie vor beliebt sind. Sie werden auch bei menschlichen Patient*innen gegen eitrige Entzündungen, Muskel- oder Gelenkbeschwerden, Verbrennungen, Frostbeulen sowie oberflächlichen Hämorrhoiden eingesetzt.
Heute wissen wir, dass die entzündungshemmende, juckreizlindernde, antibakterielle und wundheilungsfördernde Wirkung solcher Pappelknospen-Zubereitungen u.a. auf Inhaltsstoffen wie Populin, Flavonoiden, ätherischen Ölen, Harz, Gerbstoffen und Phenylglykosiden beruht. In der Rinde finden sich außerdem relevante Mengen an Salicin – das ist derselbe schmerzstillende und fiebersenkende Stoff, der einst Weide und Mädesüß ins Visier der Heilkunde rückte.
Innerlich angewendet, können Teezubereitungen aus Pappelknospen die Harnsäureausscheidung günstig beeinflussen und so Gichtbeschwerden lindern. Auch Harnentleerungsstörungen, etwa infolge gutartiger Prostatavergrößerung, sprechen offenbar positiv darauf an, vermutlich wegen der enthaltenen Zink-Lignane.
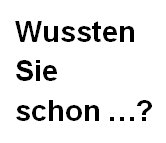 Wussen Sie schon …?
Wussen Sie schon …?

Eine Espe. Bild von congerdesign auf Pixabay
Der Begriff „Zittern wie Espenlaub“ stammt von den Blättern der Zitterpappel (Populus tremula; lat. tremere = zittern), die im Volksmund auch Espe heißt. Ihre Blätter geraten wegen der besonderen Stielform schon beim geringsten Windhauch in hektische Bewegung. Die Redensart, die besondere Furchtsamkeit ausdrücken soll, ist übrigens irreführend: Ausgerechnet diese Pappelart ist ausgesprochen widerstandsfähig, z.B. was die Toleranz von Abgasen und strengen Frösten angeht! Entsprechend empfiehlt die Bachblütentherapie die Blütenessenz Aspen für sensible, schreckhafte Menschen, die sich von äußeren Einflüssen übermäßig aus dem Gleichgewicht bringen lassen und deshalb z.B. unter Alpträumen oder geringem Selbstbewusstsein leiden.


